

21. April
Iggy Pop und Queen Elizabeth II wurden an einem 21. April geboren. Ich auch.
Das Datum scheint nicht jeden für eine Karriere als Royal oder Rockstar mit freiem Oberkörper zu prädestinieren. Eine Krone wurde mir bisher nicht angetragen und meine schon lange beendete Nicht-Karriere als Musiker verlief konsequent erfolglos und weitgehend unbemerkt.
Wer in dem Bereich des Lebens, der gemäß sozialer Übereinkunft als Realität bezeichnet wird, weder Königin noch Rockstar ist, aber trotzdem gerne wüsste, wie sich das anfühlt, der denkt sich eben Geschichten aus. Geschichten über Elizabeths und Iggys, über sprechende Salamander, bizarre Schneekugeln, Zweifelwerker, singende Wurmlöcher oder alte Prophezeiungen und rheinische Leuchtturmwärter.
Auch jede Biografie ist eine Geschichte — wobei die wirklich interessanten Szenen nur selten in der offiziellen Lebensstatistik auftauchen. Zum Beispiel, die Begegnungen, die wir im Lauf unseres Lebens haben. Begegnungen mit Menschen, Dingen oder Phänomenen, die unser Fühlen, Denken und Handeln prägen, und die beeinflussen, wer wir sind. Höchste Zeit also, für eine weitgehend eckdatenfreie Biografie der Begegnungen. Und da meine (Autoren)Biografie mir gehört und ich nichts dagegen hatte …
Hier kommen — anstelle einer Datenaneinanderreihung — acht Begegnungen aus meinem Leben, die nicht ganz unschuldig daran sind, dass, was, wie und worüber ich schreibe:

An welchem Tag die Lakritze und ich uns zum ersten Mal begegneten, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. 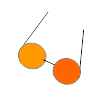 Aber ich weiß noch, wo es war. In dem kleinen Laden von Erich Noll, der die Nachrichtenzentrale unseres Dorfes war und in dem man neben Teewurst, Gemüse, Waschpulver und Illustrierten natürlich auch Süßigkeiten kaufen konnte. Und wenn man von Opa fünfzig Pfennig oder sogar eine Mark geschenkt bekam, marschierte man frohgemut dort hin und ließ sich von dem freundlichen Herrn Noll eine gemischte Tüte zusammenstellen. Bei einer dieser Gelegenheiten geschah es: Ich stand, das Markstück fest von meiner Kinderfaust umschlossen und ein wenig überfordert von der mir so plötzlich zugefallenen Entscheidungsgewalt, vor den Glasbehältern und ließ meinen Blick unentschlossen über die Auswahl süßer Versuchungen wandern — als ich sie sah! In einem Glas ganz links. Schwarzglänzend! In Form kleiner Rauten. Damals wusste ich noch nicht, dass die Lakritze Lakritze heißt (wir sind uns nie offiziell vorgestellt worden), aber ihr seltsames Äußeres erregte augenblicklich meine Aufmerksamkeit. Etwas Schwarzes, dass man essen konnte? Wie viele schwarze Lebensmittel gab es schon? Lakritze war völlig anders als die bunten Lutscher, Bonbons, Fruchtgummis und Brausetabletten. Irgendetwas an ihr war merkwürdig und sehr eigen. Sie sah aus, als wäre sie eigentlich gar keine Süßigkeit. Als wäre sie den Süßigkeiten zugeschlagen worden, weil der ratlose Herr Noll sie irgendwo einsortieren musste und sie, weil ihm nichts Besseres eingefallen war, in einem kopflosen Akt kaufmännischer Willkür neben den Fruchtgummis platziert hatte. Kurz gesagt: Die Lakritze war mysteriös genug, um meine Neugier zu wecken. Und so landeten gleich mehrere der schwarzen Rauten in meiner gemischten Tüte.
Aber ich weiß noch, wo es war. In dem kleinen Laden von Erich Noll, der die Nachrichtenzentrale unseres Dorfes war und in dem man neben Teewurst, Gemüse, Waschpulver und Illustrierten natürlich auch Süßigkeiten kaufen konnte. Und wenn man von Opa fünfzig Pfennig oder sogar eine Mark geschenkt bekam, marschierte man frohgemut dort hin und ließ sich von dem freundlichen Herrn Noll eine gemischte Tüte zusammenstellen. Bei einer dieser Gelegenheiten geschah es: Ich stand, das Markstück fest von meiner Kinderfaust umschlossen und ein wenig überfordert von der mir so plötzlich zugefallenen Entscheidungsgewalt, vor den Glasbehältern und ließ meinen Blick unentschlossen über die Auswahl süßer Versuchungen wandern — als ich sie sah! In einem Glas ganz links. Schwarzglänzend! In Form kleiner Rauten. Damals wusste ich noch nicht, dass die Lakritze Lakritze heißt (wir sind uns nie offiziell vorgestellt worden), aber ihr seltsames Äußeres erregte augenblicklich meine Aufmerksamkeit. Etwas Schwarzes, dass man essen konnte? Wie viele schwarze Lebensmittel gab es schon? Lakritze war völlig anders als die bunten Lutscher, Bonbons, Fruchtgummis und Brausetabletten. Irgendetwas an ihr war merkwürdig und sehr eigen. Sie sah aus, als wäre sie eigentlich gar keine Süßigkeit. Als wäre sie den Süßigkeiten zugeschlagen worden, weil der ratlose Herr Noll sie irgendwo einsortieren musste und sie, weil ihm nichts Besseres eingefallen war, in einem kopflosen Akt kaufmännischer Willkür neben den Fruchtgummis platziert hatte. Kurz gesagt: Die Lakritze war mysteriös genug, um meine Neugier zu wecken. Und so landeten gleich mehrere der schwarzen Rauten in meiner gemischten Tüte.
Noch auf den Stufen vor der Ladentür steckte ich eine davon vorsichtig in den Mund, schmeckte — und erlebte eine Offenbarung: Lakritze sah nicht nur anders aus, Lakritze schmeckte auch völlig anders. Nicht wie irgendeine Süßigkeit; die schmeckten letztlich alle nach Zucker. Aber Lakritze schmeckte nicht nach irgendetwas anderem. Nur nach sich selbst. Und dabei ganz unbestimmbar. Nicht süß, nicht sauer, nicht fruchtig. Sondern einfach nur lakritzig. Und ganz unglaublich lecker.
Was genau diesen Geschmack ausmacht und warum er so einzigartig ist, versuche ich bis heute herauszufinden. Meine Mission hat mich von relativ harmlosen Erfahrungen mit Weichlakritze über Experimente mit doppelt gesalzener Lakritze bis hin zu dem harten Stoff, den es nur in der Apotheke gibt, geführt — aber das Mysterium der Lakritze habe ich bis heute nicht enträtselt.
Meine Obsession hat ihren literarischen Niederschlag in So kalt wie Eis, so klar wie Glas, gefunden, wo sich die lakritzsüchtige Elsa Uhlich im Schwarzen Glück, einem Laden der ausschließlich Lakritze handelt, mit ihrer täglichen Dosis schwarzer Seligkeit versorgt.
Bei jeder Begegnung lernt man etwas. Fürs Leben, fürs Schreiben, manchmal für beides. Meine Begegnung mit der Lakritze hat mich drei Dinge gelehrt. Erstens: Lakritze bleibt immer Lakritze. Da kann man sie in die Süßigkeiten einsortieren, wie man will. Zweitens: Die wirklich interessanten Dinge findet man oft am Rande. Drittens: Wenn du einem Menschen begegnest der, auch gerne Lakritze kaut, dann hör ihm genau zu. Nicht nur, weil du sehr genau hinhören musst, wenn jemand mit vollem Mund spricht, sondern weil dieser Mensch dein Bruder oder deine Schwester im Geiste der Lakritze sein könnte …
Irgendwann, im Laufe mehrere Umzüge, ist mir Heiner, der kleine Feuerwehrmann abhanden gekommen. Was ich bis heute bedauere und beklage. Der pfiffige Heiner war der Held des ersten Buches, das ich eigenständig lesen konnte. Gefühlt hieß damals jede zweite männliche Hauptfigur in einem Kinderbuch Heiner — das ist aber auch schon das Einzige, was es an dem kleinen Feuerwehrmann zu meckern gibt. 
Heiner ist dafür verantwortlich, dass ich noch immer ein manischer Leser bin. Hätte ich seine wagemutigen Abenteuer, darunter die Rettung einer Katze aus einem Baum und seinen selbstlosen Einsatz bei einem Scheunenbrand, nicht so immens spannend gefunden — wer weiß, ob ich dann all den anderen Autoren begegnet wäre, deren Geschichten ich lesen durfte und die mich so begeistert haben, dass ich eines Tages selbst eine Geschichte schreiben wollte. Wobei mir immer die Autoren und Autorinnen am besten gefielen, deren Bücher — und da sind wir wieder bei Begegnung 1 — wie Lakritze waren. Mit einem unverwechselbaren Eigengeschmack. Den sie auch dann behielten, wenn man sie zum Fruchtgummi sortiert hatte.
Gelernt habe ich aus meiner Begegnung mit Heiner: Manchmal kann ein kleiner Feuerwehrmann ein großes Feuer der (Lese) Begeisterung in einem entfachen. Und — die Rettung einer Katze kann eine ziemlich aufregende Angelegenheit sein. Es kommt nur darauf an, wie man sie schildert.
Ob die Schneekugel mit dem Eisbär auf Eisscholle tatsächlich die erste war, der ich begegnet bin, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Nur, dass sie die erste Kugel war, an die ich mich erinnern kann — und diejenige, an deren viel zu frühem Ende mein kindlicher Übermut nicht ganz unschuldig war.

Es waren gleich mehrere Dinge, die mich an der Schneekugel faszinierten. Zum Einen bediente sie aufs Wunderbarste meine kindlichen Allmacht-Fantasien. In der Welt, in der der Eisbär lebte, war ich ein Gott. Mit einer Bewegung meiner Hand konnte ich es in dieser Welt schneien lassen. Oder auch nicht. Je nachdem, wie es mir gerade gefiel. Wem sich an dieser Stelle der Gedanke aufdrängt, dass das Schreiben von Geschichten (in denen der Autor ja nicht nur über Schneefall sondern über Glück und Unglück und das Leben und Sterben seiner Charaktere entscheidet) auch nichts anderes als ein sozialverträglicher Weg ist, um Allmacht-Fantasien auszuleben, der hat einen guten Riecher. Und irrt dennoch: Mit der Allmacht beim Schreiben ist das so eine Sache: Fiktionale Charaktere entwickeln sehr schnell ein Eigenleben und sorgen so dafür, dass sich die Geschichte in eine ganz andere Richtung entwickelt, als vom Autor geplant. Und ein paar der Brüder können echt unangenehm werden, wenn es nicht nach ihrer Nase geht …
Daneben war es eine gewisse Sinnfreiheit, die mich an der Kugel faszinierte. Anders als beim eher öden Spielen mit Lego oder dem von mir gehassten Basteln, an dessen Ende immer irgendein, in den meisten Fällen schon vorher definiertes Ergebnis stehen musste, war die Beschäftigung mit einer Glaskugel völlig unproduktiv. Die Kugel erfüllte keinen Zweck, außer dem Betrachter ein paar glückliche Momente zu schenken. Damals war es natürlich nur ein diffuses Gefühl und nichts was ich hätte formulieren können, aber gelernt habe ich bei meiner Begegnung mit der Schneekugel: Es gibt Menschen, die gerne mit Lego spielen und deren Stärke das Handeln ist. Und es gibt andere, die gerne in Schneekugeln blicken und deren Stärke das Beobachten ist.
Ein weiteres — vielleicht das größte — Faszinosum an der Kugel war, dass sie eine abgeschlossene Welt bildete, die nicht echt sondern künstlich war, die aber dennoch existierte. Innerhalb der realen, viel größeren Welt meines Kinderzimmers. Eine Welt in einer Welt. Das hat etwas beinah Magisches. Und ist das, was Schneekugeln mit Büchern verbindet. Auch sie sind Welten in einer Welt. Da lag es nahe, Kugel und Buch zusammenzubringen und Schneekugeln zu dem zentralen Motiv von So kalt wie Eis, so klar wie Glas zu machen.
Erfahren habe ich bei meiner Begegnung mit der Schneekugel also auch, dass es viele Welten in einer geben kann. Und dass man einfach welche hinzu erfinden kann, wenn man möchte.
Und ganz zum Schluss ein weiterer Erkenntnisgewinn: Schneekugeln sollte man vorsichtiger als rohe Eier behandeln — und sie keinesfalls schütteln, wenn man Chips-fettige Finger hat!
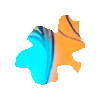 Als ich Sgt.Peppers Lonely Hearts Club Band zum ersten Mal hörte, war das Album schon 9 Jahre alt. Ich war zwölf und hatte gerade erst begonnen, mich durch die Rock- und Pop-Historie zu arbeiten. Es gab einiges nachzuholen. In meiner Kindheit hatte ich weder mit Rock noch mit Pop Berührungspunkte. Meine Eltern bevorzugten Schlagermusik und in meiner engeren und weiteren Verwandtschaft war man gegenüber Menschen, die langes Haupthaar und nicht der Norm entsprechende Kleidung trugen, ausgesprochen misstrauisch eingestellt. Begegnete einem eine dieser Erscheinungen auf der Straße, wurde gerne mal der Kopf geschüttelt und erbost gezischt: »Schon wieder so ein Beatle!« Weswegen ich als Kind dem Irrtum unterlag, Beatle sei ein abschätziger Sammelbegriff für alle Langhaarigen. Erst mit zehn klärte sich dieses Missverständnis und ich erfuhr, dass es sich bei den Beatles um eine ganz bestimmte, aus vier Engländern bestehende Gruppe Langhaariger handelte. Deren Musik ich in Windeseile verfallen war. Wobei ich zunächst die frühen Werke kennenlernte — und dann kam Sgt. Pepper.
Als ich Sgt.Peppers Lonely Hearts Club Band zum ersten Mal hörte, war das Album schon 9 Jahre alt. Ich war zwölf und hatte gerade erst begonnen, mich durch die Rock- und Pop-Historie zu arbeiten. Es gab einiges nachzuholen. In meiner Kindheit hatte ich weder mit Rock noch mit Pop Berührungspunkte. Meine Eltern bevorzugten Schlagermusik und in meiner engeren und weiteren Verwandtschaft war man gegenüber Menschen, die langes Haupthaar und nicht der Norm entsprechende Kleidung trugen, ausgesprochen misstrauisch eingestellt. Begegnete einem eine dieser Erscheinungen auf der Straße, wurde gerne mal der Kopf geschüttelt und erbost gezischt: »Schon wieder so ein Beatle!« Weswegen ich als Kind dem Irrtum unterlag, Beatle sei ein abschätziger Sammelbegriff für alle Langhaarigen. Erst mit zehn klärte sich dieses Missverständnis und ich erfuhr, dass es sich bei den Beatles um eine ganz bestimmte, aus vier Engländern bestehende Gruppe Langhaariger handelte. Deren Musik ich in Windeseile verfallen war. Wobei ich zunächst die frühen Werke kennenlernte — und dann kam Sgt. Pepper.
Es war an einem Tag im April. Krokusse sprossen aus der Erde, die Sonne wechselte sich mit kleinen Frühlingsschauern ab und als ich, das frisch erworbene Album unter dem Arm, aus der Tür des Musikhaus Neumann trat, erschien am Himmel ein Regenbogen. (Echt wahr!) Und so nahm ein wunderbar leichter und zwar drogenfreier aber dennoch etwas psychedelischer Strawberry Fields/Penny Lane-Nachmittag seinen schicksalhaften Verlauf. Wenn auch in Neuwied am Rhein statt in Liverpool. Während mich der Bus nach Hause schaukelte, betrachtete ich unentwegt das legendäre Cover mit den Beatles in ihren quietschbunten Uniformen, den merkwürdigen Grünpflanzen und der Versammlung von Berühmtheiten. Das Bild erweckte den Eindruck, als wären sie alle Teilnehmer einer sehr bunten und reichlich irrealen Beerdigung.
Zu Hause angekommen, nahm ich, da ich über keine eigene Anlage verfügte, die elterliche Musiktruhe im Wohnzimmer in Beschlag. (Wer nach 1970 geboren ist und sich gerade fragt, was eine Musiktruhe ist: eine Musiktruhe ist das, was herauskommt, wenn man ein Radio, einen Plattenspieler und zwei Lautsprecher mit einer Kommode kreuzt. Ein tönender Musikmöbel-Hybrid, den sich auch der größte Retro-Fanatiker nicht zurück wünscht.)
Ich legte den Tonarm auf, ließ mich auf dem Teppich vor der Musiktruhe nieder, schloss die Augen — und war nach dem ersten Hören schwer verwirrt. Das klang ganz anders als She loves you oder I want to hold your hand. Das war … noch viel besser! Ich hörte die Platte ein zweites Mal — und seitdem höre ich sie immer wieder. Bis heute.
Sgt. Pepper sollte es auf Rezept geben. Das Album hat therapeutische Wirkung. Vor allem dann, wenn einem die konzentrierte Blaumiesigkeit der Gegenwart mit ihrem Kontrollwahn, ihrer Aufgeblasenheit und fassadenhaften Vergnügungspark-Freiheit, ihrer zunehmenden emotionalen Verrohung, ihrem Herdentrieb und ihrer weitgehenden Humorfreiheit mal wieder in geballter Form entgegenschlägt.
Die Songs, die die Beatles in der Phase zwischen Strawberry Fields und Magical Mystery Tour aufgenommen haben, stehen für alles Gute und Schöne im Leben. Dafür, wie die Welt sein könnte, wenn wir uns entschließen würden, mal wieder ein Nümmerchen entspannter und unvoreingenommener zu werden: leicht und bunt, skurril, neugierig, verkichert, experimentierfreudig. Ein Leben, in dem sich die Grenzen auflösen, so wie sie zwischen den ineinander übergehenden Stücken des Sgt. Pepper-Albums aufgelöst wurden. Wo eine Sache nicht wichtiger als eine andere ist. Wo Ernsthaftes gleichberechtigt neben Albernem existiert. So wie Within you, without you neben einem Gassenhauer wie When I’m sixty-four. Wo Gegensätze sich befruchten, statt sich kriegerisch gegenüberzustehen. Und sich zu einem farbenfrohen Ganzen zusammenfügen. Jedes Mal wenn ich die Platte höre, erweckt sie in mir die Hoffnung, dass die öde Herrschaft der Blaumiesen bald enden und die Zukunft wie ein Sergeant Pepper-Album sein wird …
Hier sind ein paar Dinge, die ich bei meinen Begegnungen mit Sgt. Pepper gelernt habe: Wenn indischer Mystizismus, Songs über Löcher in Blackburn/Lancashire, über entzückende Politessen und Benefizveranstaltungen für Mr. Kite zusammen auf einem Tonträger funktionieren, können in Büchern auch Winterdämonen zusammen mit weinenden Polizisten und lakritzsüchtigen Holzfällerinnen, UFOs in Kombination mit unglücklich agierenden Philosophielehrern und schamanischen Fahrschullehrerinnen, oder bedrohliche Geistwesen in Verbindung mit Leuchttürmen und rheinischem Frohsinn funktionieren. Eine Prise Sgt. Pepper schadet einer Geschichte nie. Während ich an Miranda Lux geschrieben habe, lief das Album bei mir rauf und runter.
Gelernt habe ich bei meiner Begegnung mit Sgt. Pepper außerdem, wie viele Löcher es braucht um die Albert-Hall zu füllen, und dass man schon klarkommt, solange man ein bisschen Unterstützung von Freunden hat. Und das ich Brillen mit runder Fassung mag. Am liebsten mit bunten, pepperigen Gläsern.
Es gibt Bücher, die dem Leser intellektuellen Erkenntnisgewinn verschaffen, Bücher, die wunderbar unterhaltend sind (im besten Falle natürlich beides) und es gibt Bücher, die einem in trostlosen Situationen Trost sein können. Die Autoren dieser Bücher werden zu Freunden, die einem die Hand halten und von denen man sich verstanden fühlt, wenn es gerade mal wieder nicht so kugelrund läuft. Das Erste was ich von Hermann Hesse gelesen habe, war seine Kurzgeschichte Der Wolf und seitdem hat er mir ziemlich oft die Hand gehalten. Sei es nun in Gestalt des Malers Klingsor, als Max Demian oder Harry Haller … Ich habe sicher nicht alles, aber sehr viel von und über Hesse gelesen. Und dabei auch gelernt, dass er nicht von jedem geschätzt wird: Zu Beginn der Oberstufe bekamen wir im Deutsch-Leistungskurs von unserer Kursleiterin Frau Dr. Frank eine lange Liste deutschsprachiger Literatur überreicht, verbunden mit der dringlichen Aufforderung, diese Leseliste in den kommenden drei Jahren abzuarbeiten. Um es mal vorweg zu nehmen: Frau Dr. Frank war das Beste, was einem Deutsch-Leistungskurs widerfahren konnte. Weil sie ihre Schüler ernst nahm, ohne sie zu ernst zu nehmen. Weil ihr Unterricht interessant bis kurios war. Weil sie einen für Literatur begeistern konnte. Und weil sie eine echte Persönlichkeit war, die vor der Rückgabe einer Kursarbeit auch schon mal einen enttäuschten Blick auf ihren nichtsnutzigen Leistungskurs werfen und mit trauriger Stimme verkünden konnte: »Ich habe eine Flasche Cognac gebraucht, um Ihre Arbeiten zu korrigieren.« Aber damals, an dem Tag an dem sie uns die Literatur-Liste in die Hand drückte, wusste ich noch nicht, wie großartig sie war, sondern befürchtete, dass unsere Beziehung in den kommenden drei Jahren kompliziert werde könnte: Nicht nur ich, auch eine meiner Mitschülerinnen schien einen Namen auf der Liste zu vermissen. Und als sie fragte, warum denn kein Buch von Hesse auf der Liste stünde, der sei doch schließlich Nobelpreisträger, verzog Frau Dr. Frank schmerzvoll das Gesicht, schaute mit betrübtem Blick aus dem Fenster und seufzte: »Ach, Hesse … Der Mann ist doch ein Schwätzer …«
Heute bin ich sehr froh, sowohl Hermann Hesse wie auch Frau Dr. Frank begegnet zu sein. Gelernt habe ich: Man kann mit jemandem in einer grundlegenden Sache uneins sein und dennoch viel von ihm lernen. Gelernt habe ich aber auch: Sind Autor und Leser Seelenverwandte, hält ihre Liebe jeder Form von Literaturkritik stand.
s. Begegnung der fünften Art. So wie es Autoren gibt, die zu lebenslangen Freunden werden, so gibt es auch Bands, die einen durch alle Höhen und Tiefen einer Biografie begleiten und dabei den Soundtrack des Lebens spielen. Seit mittlerweile fast vierzig Jahren betreibt Robert Smith mit wechselnder Belegschaft The Cure. Das Tolle an ihnen ist, dass ihre Musik so ziemlich das gesamte Gefühlsspektrum abdeckt, das man haben kann. Von One hundred years, dem Musik gewordenen Gefühl absoluter Hoffnungslosigkeit, über melancholische Stücke wie Charlotte Sometimes und wunderbare Liebeslieder wie Just like heaven, bis hin zu herrlich übergeschnappten Nummern wie Doing the unstuck.
Die Idee zu Salamandersommer hatte ich während des ungefähr dreißigtausendsten Hörens von A Forest.
Gelernt habe ich aus meiner Begegnung mit The Cure, dass sich alle Facetten des persönlichen Gefühlsspektrums kreativ ausbeuten lassen. Und dass es nicht nur zwischen Lesern und Autoren, sondern auch zwischen Hörern und Bands wahre Liebe gibt. Außerdem habe ich Robert Smith — der übrigens auch ein an einem 21. April Geborener ist — die elementare Erkenntnis zu verdanken, dass man durchs Leben gehen kann, ohne sich die Schuhe zu binden!
Als die erste Folge von Twin Peaks im September 1991 ausgestrahlt wurde, saß ich, wie viele andere auch, mit offenem Mund vor dem Fernseher und versuchte zu verstehen, was da gerade passierte. Twin Peaks brach mit sämtlichen Serien-Konventionen und unterlief jede Erwartungshaltung des Zuschauers. Twin Peaks war gleichzeitig Krimi und Thriller, Mystery, Horror, Comedy und Soap-Opera. Und verfügte über einige der skurrilsten Charaktere, die man bis dahin gesehen hatte. Einen FBI-Agent, der bei seinen Ermittlungen auf tibetische Weisheiten zurückgriff. Einen Polizist, der beim Anblick einer Leiche in Tränen ausbrach. Die einäugige Nadine, die von einer geräuschlosen Vorhangschiene träumte. Außerdem eine Lady mit Holzscheit, koksende Highschool-Prinzessinnen, uralte Zimmerpagen und weissagende Riesen. Es gab Szenen in denen rückwärts gesprochen wurde, eine Begegnung mit einem Lama im Tierarzt-Wartezimmer, es gab den Angst einflößenden Bob, den wunderbar zynischen Dr. Rosenfield und einen Fisch im Kaffeefilter. Man wusste nie, was einen als nächstes erwartete. Auf eine völlig alberne konnte eine sehr bewegende und im nächsten Moment eine total verwirrende oder schockierende Szene folgen. Das Ganze war wie Sgt. Pepper. Nur eben von David Lynch.
Lerneffekt: 1) Die Jagd auf einen Dämon ist ein interessantes erzählerisches Motiv. Ein Gespräch über Kirschkuchen und Kaffee aber auch. 2) Die Eulen sind nicht, was sie scheinen. 3) Keine Angst vor kruden Genre-Mischungen.
Der Geist des Arschtritts begegnete mir irgendwann zu Beginn des Jahres 2010. Er stand plötzlich bei mir in der Wohnung. Wie hingehext. Ein genervtes und schlecht gelauntes, miesepetriges Männchen. Er sah mich vorwurfsvoll an, seufzte tief, drehte mich an den Schultern herum und verpasste mir einen kräftigen Tritt in den Allerwertesten.
»Ah! Autsch! He, was soll das? Wie kommen Sie hier rein? Wer sind Sie? Wieso treten Sie mir in den Hintern?«
»Weil das mein Job ist, du Vollhonk! Ich bin der Geist des Arschtritts.«
»Der, äh, was?«
Er zog ein abgewetztes Notizbuch aus der Tasche und warf einen kurzen Blick hinein, dann nahm er mich ins Visier und fragte in mürrischem Ton: »Du bist doch der Typ, der seinen Freunden ständig erzählt, dass er schreiben will und jede Menge Ideen für Geschichten im Kopf hat. Oder?«
»Ähm, ja schon. Aber …«
»Ideen die man im Kopf hat, bleiben nur Ideen, wenn man sie nicht irgendwann auch zu Papier bringt. Erst dann werden es Geschichten und vielleicht auch irgendwann mal Bücher. Also fang endlich an!«
»Wie? Jetzt direkt? Aber … auh!« Der nächste Tritt.
»Kein aber! Fang an! Jetzt! Los!«
Eingeschüchtert hockte ich mich vor den PC, öffnete das Schreibprogramm und starrte überfordert auf den Monitor.
»Na, mach schon!«, kommandierte er. »Ich dachte, du hast so famose Ideen. Dann erzähl doch mal. Worum soll es denn gehen in deiner Geschichte?«
»Also … um … um einen sprechenden Salamander und ein Mädchen mit roten Haaren, das den Regen langsamer fallen lassen kann und Kräuterzigaretten und eine zickige Musiklehrerin und ein Gift namens Samandarin und …«
»Ist doch schon mal was. Und klingt bescheuert genug, um funktionieren zu können. Leg los!«
Ich schluckte, überlegte einen Moment, fuhr zögerlich mit den Fingern über die Tastatur und auf dem Monitor erschien der Satz: Es ist der Regen, der mich weckt.
»Sehr schön«, befand der Geist des Arschtritts. »Ab jetzt wird es leichter. Mach einfach immer weiter. Einen Satz nach dem anderen. Na los! Hopp, hopp!« Er setzte sich in einen Sessel und beobachtete mich mit finsterem Blick.
Und da sitzt er noch immer.
Und steht nur gelegentlich auf, wenn er der Meinung ist, es wäre mal wieder Zeit für einen kräftigen Tritt in meinen Arsch.